Nachdem die Gebäudetechnik in vergangenen Dekaden immer komplexer wurde, ist seit einigen Jahren der Wunsch nach Lowtech gewachsen. Statt hochentwickelte Gebäudetechnologie werden einfache Systeme und natürliche Wirkungsprinzipien genutzt. Modulart hat sich mit Pionier Beat Kegel darüber unterhalten, wie viel Technik in einem Gebäude nötig ist und wie das System Kegel funktioniert.

Mein Ansatz ist nicht Lowtech, sondern Raumkomfort.
Beat Kegel, Kegel Klimasysteme
Herr Kegel, wie muss ein Gebäude beschaffen sein, damit Lowtech funktioniert?
Beat Kegel: In einem Gebäude mit einer – vereinfacht gesagt – guten Hülle, das die Sonnenenergie und die Nutzenden berücksichtig, entsteht Lowtech wie von selbst. In so einem Haus kann man die Haustechnik-Anlagen halb so gross planen, weil das Gebäude den Grossteil des Heizens und Kühlens selbst macht: zu zwei Drittel oder sogar drei Viertel. Architektur und Technik bilden eine Einheit. Sie müssen aber schon so geplant werden.
Was sind die Grundbausteine Ihres Systems?
BK: Mein Ansatz ist nicht Lowtech, sondern Raumkomfort. Ich gestalte Gebäude, in denen es den Nutzenden wohl ist. Dazu braucht es wie gesagt ein gutes Gebäude: Es muss nicht nur gut isoliert sein, sondern eine thermisch aktivierbare Masse haben. Man braucht sie, um die Wärme aufzunehmen und zwischenzuspeichern.
Beim Beispiel eines neu gebauten Schulzimmers geben die Schüler, kaum sind sie im Raum, zwei- bis dreimal so viel Wärme ab, wie man zum Heizen braucht; auch wenn draussen Minustemperaturen herrschen. Wenn aber für eine bessere Akustik über die ganze Betondecke Steinwollplatten gehängt werden, kann die Decke keine Wärme aufnehmen. Das heisst, es wird zu warm im Zimmer, die Fenster werden aufgerissen, die Wärme geht raus, und wenn die Schüler das Zimmer verlassen haben, muss sich die Heizung einschalten. Deshalb gilt es in diesem Fall, die Akustikanforderung anders zu erfüllen. Dann kann die Abwärme der Kinder in der Decke zwischengespeichert werden, und es braucht weder tags noch nachts eine Heizung.
In Gebäuden mit Ihrem System wird nach innen gelüftet. Wieso?
BK: In einem modernen, gut isolierten Bau, wie ich ihn plane, kommt die frische Zuluft vom zentralen Raum, etwa einem Korridor, die Abluft fliesst meist über dem WC-Raum ab. In diesen Räumen gelangt die Zu- und Abluft via ein Lüftungsgerät vom Aussen- in den Innenraum und umgekehrt. Der Luftaustausch funktioniert ganz automatisch, das ist einfache Physik: Gebrauchte warme Luft zieht oben ab, frische kühlere Luft kommt von unten herein und verteilt sich von selbst in die Räume. Damit der Luftaustausch funktioniert, müssen die Türen zum Gang offen sein. Falls eine Tür zu sein soll, zum Beispiel in einem Bürogebäude oder Schulhaus, baue ich Verbundlüfter in die Türen ein. Diese Elemente tauschen Luft fast unhörbar zwischen Korridor und Räumen aus. Bei Bauten an einer lärmigen Strasse hat das Nach-innen-Lüften auch den Vorteil, dass ich das Fenster nicht öffnen muss.
Funktioniert Ihr System gleichermassen für Neu- und Umbauten? Und gibt es Gebäude, die sich für Ihren Ansatz gar nicht eignen?
BK: Ich unterscheide Neu- und Umbauten nicht prinzipiell. Auch ein Umbau muss bei mir so gut werden wie ein Neubau. Meist haben Altbauten viel Masse, deshalb eignen sie sich gut. Gebäude mit Glasfassaden packe ich jedoch nicht an. Da gibt es so viele Ausseneinflüsse und kaum Masse, da funktioniert Lowtech zu wenig.
Spürt der Nutzer etwas vom Lowtech-Ansatz?
BK: Nein, er muss nichts einstellen, das System wirkt unmerklich. Und ich überlasse dem Nutzer nicht alles. In einem Bürogebäude schaue ich im Winter, dass die Räume am Morgen warm sind und die Gebäudemasse Energie aufnehmen kann. Auch jene Räume, in denen der Regler nicht auf «heizen» steht, bekommen etwas Wärme. Wenn dann die Menschen in die Räume kommen, geht die Wärme in die Masse über und wird dort gespeichert.
Im Sommer kühle ich die Räume nachts auf 23 Grad, sodass es am Morgen, wenn die Leute kommen, angenehm kühl ist. Es ist eine vorausschauende Bewirtschaftung, die nicht dem Nutzer überlassen wird. Tagsüber kann er die Temperatur selbst einstellen, aber in der Nacht gibt es immer ein Reset, das Ruhe ins Gebäudesystem bringt.
Wie haben Sie Ihr System entwickelt?
BK: Alles begann damit, dass in den 1980er-Jahren die Börsenarbeitsplätze vom Ring wegkamen. Damals gab es noch wenige klimatisierte Bürogebäude, es hatte kaum jemand einen Computer. Doch plötzlich gab es Händler, die nicht einen, sondern zehn Computer hatten. In den Räumen wurde es 35 oder 38 Grad warm. Ich arbeitete damals bei der Firma Sulzer und kam auf der ganzen Welt herum. Als ich sah, dass die Standardkühlung in den Räumen mit den Börsenarbeitsplätzen nicht funktionierte, habe ich einen Kühltisch entwickelt. Das war ein Riesenerfolg.
Ausgehend davon habe ich das System weiterentwickelt. Es kamen normale Büroräume dazu, später Schulbauten und vor rund zwei Jahren Wohnbauten. Dafür erhalte ich im Moment sehr viele Anfragen. Und nun, wo ich 65 bin, kommen sogar noch Kirchenräume dazu. Wir sanieren derzeit eine Kirche in Fällanden und eine in Zürich-Wiedikon. Wir entwickeln dafür, vereinfacht gesagt, heizbare Möbel, die wir in den Kirchenraum stellen. Ich bin gespannt, ob sich das – wie der Kühltisch in den Händlerräumen – durchsetzt.
Bei gängigen Lüftungsanlagen findet man kilometerweise Rohrleitungen. Hat sich die Branche in Materialschlachten verloren?
BK: Die mechanische Belüftung eines Gebäudes mit der Luftmenge, die der maximalen Belegung jedes Raumes entspricht, führt zu sehr hohen Volumenströmen und einem grossen Rohrnetz. Die Luftmenge liegt in Bürogebäuden bei 4 bis 5 Kubikmetern pro Stunde und Quadratmeter, mit der effektiven Belegung bei etwa 100 Kubikmetern pro Stunde und Person. Dies entspricht der gängigen Praxis, viele Planer setzen das so um.
Ich installiere lediglich 1,5 Kubikmeter pro Stunde und Quadratmeter und benötige kein horizontales Rohrnetz. Klagen über zu wenig Luft erhalte ich keine; vielmehr Lob für die gute Luftqualität und eine hohe Luftfeuchtigkeit im Winter.
Was kosten Ihre Lösungen im Vergleich zu klassischen Ansätzen?
BK: Mein System ist klar günstiger. Es kostet 30 bis 50 Prozent weniger als eine herkömmliche Lösung. Auch die Energie- und Wartungskosten sind tiefer. Für meinen Ansatz braucht es aber die Bereitschaft für eine Umstellung. Das stellt die Branche vor gewisse Herausforderungen.
Wird es dennoch gelingen?
BK: Wenn ein System gut ist und der Markt realisiert, dass es auch mit weniger Technik geht, dann pendelt sich das selbst ein. Doch dafür braucht es in der Regel zehn Jahre, in denen die Firmen vertrauen fassen, Projekte evaluieren und sich eine Kultur dafür etabliert.
Ich bin überzeugt, dass sich die Planung ändern wird, weil mittlerweile mehrere kreative Lowtech-Lösungen auf den Markt kommen. Welche sich durchsetzt, wird sich noch zeigen.
Werden die neuen Ansätze heute in der Ausbildung schon vermittelt?
BK: Ich fürchte nicht. Das merke ich, wenn ich mit jungen Absolventen ein Projekt mache. Sie sagen, sie hätten das anders gelernt, als ich es mache.
Ihr System ist stark auf die Nutzung abgestimmt. Was passiert, wenn ein Gebäude eine neue Nutzung erhält?
BK: Natürlich kann ich aus einem Schulhaus keinen Händlerraum machen. Aber je mehr ein Gebäude selbst übernimmt, desto flexibler ist man in der Nutzung. Es ist kein Kostenpunkt, Gebäude flexibel zu machen, sondern ein Entscheid.
Welches Ihrer Gebäude finden Sie am gelungensten?
BK: Ich habe schon mehr als hundert Gebäude mit meinem System gebaut. Sie funktionieren gut, sind jedoch nicht alle gleich effizient. Der Swisscom Business Park in Ittigen, der vor acht Jahren fertig wurde, war für die Branche extrem neu: Der Bau wurde 2016 mit dem Prix Watt d’Or in der Kategorie «Gebäude und Raum» ausgezeichnet. Punkto Investitionskosten ist es das günstige Gebäude von Swisscom.
Besonders gut gelungen ist auch die Sanierung eines Bürogebäudes an der Rosenbergstrasse in St. Gallen, das heute vom Institute of Computer Science der HSG genutzt wird. Dort hat der Bauherr voll mitgezogen. Auch dieses Projekt wurde mit dem Watt d’Or ausgezeichnet.
Das Mehrfamilienhaus Neuraum, das mit Schärholzbau in Horw entstand, ist das erste grössere Wohngebäude, das ich geplant habe. Es funktioniert gut, auch wenn ein Holzbau sich etwas anders verhält als ein Massivbau. Grad letzthin, an einem grüseligen, verregneten Wintertag, habe ich eine Gruppe von Leuten durch das Haus geführt. Als wir reinkamen, herrschten wohlige 23 Grad. Die Leute waren beeindruckt.
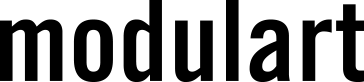




Schreiben Sie einen Kommentar
Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.