Spitäler sind das Herzstück unseres Gesundheitswesens. Spitalimmobilien bilden die Hülle darum. Der technologische Fortschritt in der medizinischen Versorgung ist rasant. Und jener der Spitalimmobilie? Welche Hülle braucht das Spital der Zukunft? Wie viel Spitalbau braucht es überhaupt? Welches Spital wollen die verschiedenen Anspruchsgruppen? Und haben modulare Lösungen ihren Platz? Wir haben uns mit Christoph Jäggi, einem Experten für Spitäler, unterhalten
Interview: Marion Elmer und Tamás Kiss
Wie werden heute in der Schweiz Spitäler gebaut?
Christoph Jäggi: Heute wird im Spitalbau oft kopiert, was schon die letzten Jahrzehnte funktioniert hat, ohne sich die Frage zu stellen, welche Spitalimmobilie man in 15, 20 oder sogar 30 Jahren braucht. Und fast überall ist der Bauprozess abgekoppelt von den Bedürfnissen der Patientinnen und jenen, die wissen, welche Räume ein optimaler Patientenbehandlungsprozess benötigt. Am Schluss steht etwas da, das nicht genügt und im Tagesgeschäft suboptimal funktioniert. Zudem verändern sich während der langen Bauzeit einer Spitalimmobilie die Planungsannahmen. In Wattwil hat man zum Beispiel soeben für 60 Millionen einen Neubau hingestellt und dann gemerkt, dass man ihn eigentlich gar nicht mehr braucht.
Im Spitalbau muss künftig zwingend modular geplant und gebaut werden: Denn aus einem Spitalbau müssen jederzeit neue Nutzungen, etwa für die Langzeitpflege oder die Rehabilitation, entstehen können.
Christophe Jäggi
Machen sich die Verantwortlichen zu wenig Gedanken? Oder wo liegt das Problem?
CJ: Nicht die Unüberlegtheit, sondern die grossen Veränderungen im Gesundheitswesen und die Komplexität eines Spitalbauprojekts sind das Problem. Zurzeit wollen wir verkrampft das Richtige für jedes einzelne Spital bauen. Dabei müsste man fragen: Bauen wir etwas, was wir brauchen und refinanzierbar ist? Bauen wir aus isolierter Perspektive oder aus Gesamtsicht? Und was ist die Gesamtsicht? Der Kanton, die Region, die Schweiz?
Gibt es diese Gesamtsicht in anderen Ländern?
CJ: Ja. Dänemark beispielsweise setzt auf eine nationale Strategie und baut nun auf der grünen Wiese neue grosse Superspitäler fürs ganze Land. Auch dort ist nicht alles optimal gelöst. Eine nationale Strategie zu haben, ist aber richtig.
Was muss sich im Spitalbau grundsätzlich ändern?
CJ: Wir müssen das Bauen künftig verstärkt als Transformation denken. Für mich sind die Olympischen Spiele in London ein gutes Vorbild: Da hat man die Bauten und die Infrastruktur über den Anlass hinausgedacht. Ab Tag eins nach der Olympiade entstand aus dem Olympiaviertel ein neuer Stadtteil von London. Wir müssen also so bauen, dass Bauten umgenutzt werden können. Wenn morgen der Entscheid kommt, dass ein stationärer Spitalstandort zu einem ambulanten Behandlungszentrum umfunktioniert wird, muss der Spitalbau mit wenig Aufwand adaptierbar sein.
Würden da modulare Lösungen nicht Sinn machen? Und ist diese Bauweise bei den Spitalplanern überhaupt präsent?
CJ: Ich habe einige modulare Spitalbauten gesehen, etwa Bettenhäuser bei Neubauprojekten, die für die Phase der Bauzeit als temporäre Rochadeflächen dienten. Sonst wird noch mehrheitlich klassisch gedacht. Die Bauindustrie hat letztlich kein Interesse, weniger Geld zu verbauen, und die Architekten wollen Vorzeigebauten hinstellen. Ich bin aber der Meinung, dass künftig zwingend modular geplant und gebaut werden muss. Denn aus einem Spitalbau müssen jederzeit neue Nutzungen, etwa für die Langzeitpflege, die Rehabilitation oder Alterswohnungen entstehen können.
Setzt sich der Gedanke der anpassbaren Bauten durch?
CJ: Weltweit versuchen viele Spitäler, diese Entwicklung aufzunehmen. Im Universitätsspital Karolinska in Schweden sind beispielsweise Statik und Raumhöhen so entwickelt, dass man das Gebäude jederzeit umnutzen könnte.
In den USA werden Spitalbauten heute so geplant, dass sie mit der Nachfrage mitwachsen. Ein Beispiel ist die Everett Clinic nördlich von Seattle, für die erst mal nur zwei ambulante Operationssäle geplant wurden. Weitere sind nach Bedarf zubaubar. Speziell an dieser Klinik ist auch, dass sie zwei verschiedene Zugänge hat: Von vorne treten die Patientinnen und Patienten ein, von der Rückseite das medizinische Personal. Eine persönliche Begegnung findet erst im Untersuchungs- und Behandlungsraum statt.
Wozu dienen die getrennten Zugangswege?
CJ: Es geht im Wesentlichen darum, die Patienten in den Mittelpunkt zu stellen und ihnen so schnell wie möglich die richtige Behandlung zukommen zu lassen. In herkömmlichen Notfallstationen läuft es bis anhin meist so ab, dass die schwersten Fälle am schnellsten behandelt werden. Patienten mit weniger schweren Symptomen müssen meist lange warten, bevor sie der Assistenzarzt, der am wenigsten Erfahrung hat, untersucht; erst in einem zweiten oder dritten Schritt kommt die Oberärztin der Inneren Medizin dazu. War die erste Diagnose zu vage oder falsch, geht das Spiel von vorne los.
Wie kann man diesen Prozess verbessern?
CJ: Wir haben uns gefragt, was passiert, wenn wir den Prozess umdrehen und die erfahrensten Mediziner bei allen Fällen an den Anfang des Prozesses nehmen. Sie können die richtige Diagnostik und Behandlung viel besser und schneller festlegen. Anschliessend behandelt ein zweiköpfiges medizinisches Team, bestehend aus Ärztin und Pfleger, die Patienten gemäss Anweisungen der Experten. So können Patienten mit undramatischen Verletzungen die Notfallstation viel schneller wieder verlassen.
Welche Räume oder Elemente braucht es für einen solchen Prozess?
CJ: Dafür braucht es eine gewisse Anzahl sogenannter MTE-Kojen, in der das medizinische Team innert weniger Minuten entscheidet, wie der Prozess für die Patienten weitergeht. Nur wer länger bleiben muss, begibt sich anschliessend tiefer in den Raum des Spitals.
Nötig ist also eine Kombination aus Raum-, Prozess- und Kulturveränderung? Wie kommt das beim Personal an?
CJ: In einer auf Expertise basierten Organisation wie dem Spital sind Veränderungen anspruchsvoll. Das ideale Vorgehen sehe ich als Verhandlungsprozess, während dem man die verschiedenen Interessen zu verstehen versucht und der – und das ist ganz wichtig – in einer praktischen und haptischen Simulation abläuft.
Wie muss man sich so eine Simulation vorstellen?
CJ: Wir haben beispielswiese die Prozesse für den Neubau zweier Kinderambulanzen des Unispitals Graz simuliert und dabei den Raum zu den Prozessen mitentwickelt. Uns stand dafür ein grosses Festzelt auf dem Parkplatz des Spitals zur Verfügung. Darin haben wir uns mit einem Team aus allen Berufsgruppen, Patientinnen und Patienten mitsamt deren Eltern sowie mithilfe von Kartonwänden und -elementen an einen optimalen Raumfluss herangetastet. Die Architektinnen und Planer beobachteten die Simulation und gaben zwischendurch Empfehlungen ab, wie man bestimmte Situationen räumlich optimieren könnte. Später haben zwei Schulklassen das neue Setting einen Tag lang getestet und uns wertvolle Rückmeldungen gegeben.
Gibt es ein schon einen Spitalbau, der solche Ansätze architektonisch umsetzt?
CJ: Ja, beispielsweise das Orbis Medical Centre in Holland. Im Parterre funktioniert es wie eine Shoppingmall mit verschiedenen Zonen, in denen das ambulante Tagesgeschäft abläuft. In den oberen Geschossen befinden sich die stationären Bettenstationen und unter dem Dach eine riesige, offene Bibliothek sowie eine Co-Working-Zone, die das klassische Arztbüro ersetzt. Mit vielen flexibel nutzbaren Zonen will man nicht nur den Patientinnen und Besuchern, sondern auch dem Personal einen Ort bieten, an dem sie sich austauschen können. Aus Studien wissen wir, dass Menschen in Büros, die mehr als zwölf Meter voneinander entfernt sind, sich gerade so gut auf einem anderen Kontinent befinden könnten.
Ihr Fazit?
CJ: Beeinflusst von der ganzen Bauindustrie plant man im heutigen Spitalbau noch zu oft klassisch, statt künftige Umnutzungen mitzudenken. Der Kostendruck und die Digitalisierung in der Bauindustrie dürften in den kommenden Jahrzehnten dazu beitragen, dass Spitalimmobilien transformationsfähiger und effizienter geplant und gebaut werden.

Christoph Jäggi hat sich darauf spezialisiert, Spitäler bei ihrer strategischen Positionierung und der damit verbundenen medizinischen Entwicklungsplanung zu beraten. Das Zusammengehen von Spitälern oder ganzen Spitalregionen führt zu spannenden Fragestellungen. Im Zentrum stehen für ihn der erzielte Nutzen für Patientinnen und Patienten sowie der Verhandlungsprozess mit Schlüsselpersonen der Spitäler sowie der breiten Öffentlichkeit. Jäggi studierte Volks- und Betriebswirtschaft, hat ein Executive MBA in Business Engineering und ist zertifizierter Global Negotiator. Bevor er 2000 in die Beratung einstieg, war er Mitglied der Direktion der Swiss Life in Zürich. Nach 20 Jahren als Mitgründer und Managing Partner der walkerproject AG ist er seit 2021 Co-Founder der schwedischen Firma Comentum AB.
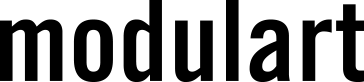


Schreiben Sie einen Kommentar
Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.