Für ihren visionären kulturellen Brückenschlag erhielt die Kunsthalle Tallinn Mitte November 2024 den Prix Kunst und Ethik 2024. Anlässlich der Preisverleihung sprach Modulart mit Paul Aguraiuja, dem Direktor der Kunsthalle Tallinn, und dem Künstler George Steinmann, der den Preis vergibt.
Interview: Marion Elmer
[1] Der Künstler George Steinmann übergibt Paul Aguraiuja, dem Direktor der Kunsthalle Tallinn, den Prix Kunst und Ethik 2024.
[2] Gruppenfoto (v.l.n.r.) der Vortragenden an der Preisverleihung: Peter Marthaler, Publizist und Moderator; George Steinmann, Künstler und Initiator; Paul Aguraiuja, Direktor Kunsthalle Tallinn; Iliana Fokianaki, Direktorin Kunsthalle Bern; Alec von Graffenried, Stadtpräsident Bern.
[3] George Steinmann spricht über die Kunsthalle Tallinn, die er in den 1990er-Jahren im Rahmen seines Werk «Ruumi naasmine» (The Revival of Space) saniert hat.
Fotos: David Aebi
Wie kam es, dass die Kunsthalle Tallinn in der Peripherie der Stadt einen temporären Pavillon für zeitgenössische Kunst eröffnete?
Paul Aguraiuja: Es begann alles vor etwa drei Jahren, als wir feststellten, dass die Kunsthalle in Tallinn in einem so schlechten Zustand ist, dass eine Gesamtrenovation nötig ist. Was sollten wir tun? Da die Kunsthalle die älteste und wichtigste zeitgenössische Kunstinstitution in Estland ist, war es keine Option, während des Umbaus zu pausieren. Wir haben einen Regierungsauftrag. Schnell war uns klar, dass wir dieser Phase eine Bedeutung geben wollten, die über das reine Ausstellen von Kunst hinausgeht. Zuerst haben wir überlegt zwei oder drei Jahre lang mit einem speziellen Zug in kleineren Städten und Dörfern von Estland Halt zu machen, in denen die zeitgenössische Kunst weitgehend unbekannt ist. Doch letztlich wären unsere Aufenthalte an diesen Orten zu kurz gewesen, um etwas zu bewirken. So kamen wir auf Lasnamäe, einen Aussenbezirk von Tallinn. Wäre Lasnamäe eine eigene Gemeinde, dann wäre sie mit ihren 120 000 Einwohnerinnen die zweitgrösste Stadt Estlands. Der Bau der Siedlung, des sogenannten Mikrorayons, begann Mitte der 1980er-Jahre. Wegen des Zusammenbruchs der Sowjetunionen wurde er jedoch nie ganz fertiggestellt. Es gibt dort Hauptstrassen, Geschäfte und Wohnhäuser, Kindergarten und Schulen, aber keinerlei kulturelle Einrichtungen – lediglich ein Kino mit einem Saal, das heute als Kulturhaus dient, mit verschiedenen Konzerten und Clubs für Kinder und Senioren. Und das für 120 000 Menschen!
Wer sind diese Menschen?
Paul Aguraiuja: Lasnamäe ist ein Teil der Stadt, in dem man ausser schlafen und einkaufen nicht viel machen kann. Es kostet wenig, hier zu leben. Es ist kein Ghetto im klassischen Sinne, aber wenn du vom Land in die Stadt ziehst, wenn Estnisch nicht deine Muttersprache ist, startest du höchstwahrscheinlich von diesem Ort aus. So haben 75 Prozent der Bewohner Russisch als Muttersprache. Deshalb wird in Lasnamäe in den meisten Kindergärten und Schulen immer noch in russischer Sprache unterrichtet. Erst diesen September starteten erstmals alle ersten Klassen mit Estnisch als Unterrichtssprache.
Wie fiel der Entscheid für Lasnamäe letztlich?
Paul Aguraiuja: Wir fanden, dass der Ort eine hervorragende Herausforderung für unser Programm sein würde. Glücklicherweise war die lokale Bezirksregierung sehr entgegenkommend. Sie zeigte uns mehrere bestehende Veranstaltungsorte. Doch die Gebäude waren in schlechtem Zustand, die meisten zudem auch kommerziell genutzt. Wir befürchteten, dass sie nach Ablauf unserer Intervention nur als rein kommerzielle Orte weiterbestehen würden. Dann sahen wir diesen leeren Platz, wo der Pavillon heute steht. Und da wir bereits 2011, als Tallinn Kulturhauptstadt Europas war, ein temporäres Gebäude gebaut hatten, wussten wir, was es heisst, etwas Vorübergehendes zu bauen.
Mit Salto, die Sie von der Zusammenarbeit im Jahr 2011 kannten, hatten Sie auch erfahrene Architekten an Bord. Wie lief der Prozess ab?
Paul Aguraiuja: Von der ersten Idee bis zur Eröffnung brauchten wir zehn Monate. Der Pavillon sollte so nachhaltig wie möglich sowie zerlegbar und verschiebbar sein. Deshalb besteht er aus vorgefertigten Elementen. Sie wurden innert fünf Monaten vorfabriziert, dann auf 14 Lastwagen verladen und innerhalb von zwei Monaten vor Ort aufgebaut (siehe auch Artikel «Elefant im postsowjetischen Hof»).
Wo fand die Vorfabrikation statt?
Paul Aguraiuja: Nachdem die Architekten die ersten Zeichnungen angefertigt hatten, suchten wir estnische Firmen, die den Pavillon auch tatsächlich bauen können. Erst als diese grünes Licht gaben, begannen die Architekten mit den Bauplänen. Da der Pavillon mit staatlichen Geldern gebaut wurde, mussten wir den Auftrag öffentlich ausschreiben. Wir hofften, dass sich die Firmen, mit denen wir die Machbarkeit bereits besprochen hatten, bewerben und gewinnen. Zu unserer Überraschung meldeten sich sehr viele weitere Unternehmen, die mit diesem Projekt neue Erkenntnisse und Erfahrungen sammeln wollten. Die Firma, die zuletzt das Rennen machte, war sehr gut. Sie konnte noch mehr aus den Plänen der Architekten herausholen, die Produktion effizienter gestalten. Alle Dimensionen des Hauses wurden so geplant, dass die Elemente so effektiv wie möglich aus Holz gefertigt werden können. Deshalb ist der Pavillon sechs Meter breit. Denn wenn man über sechs Meter geht, bräuchten die Holzbalken eine Metallverbindung. Dank des symmetrischen Grundrisses mussten nur wenige unterschiedliche Elemente entwickelt werden.
Der Pavillon wurde vor zwei Jahren eröffnet. Was waren die ersten Reaktionen der lokalen Bevölkerung?
Paul Aguraiuja: Zu Beginn haben wir viel Kritik von der lokalen Bevölkerung erhalten. Viele sind es nicht gewohnt, zeitgenössische Kunstausstellungen zu besuchen. Zudem ist das Haus so auffällig rosa und hat eine seltsame Form. Warum konnte es nicht ein normales Gebäude sein? Wir haben auch kritische Kommentare zu den Ausstellungen erhalten. Das ist auch verständlich: Wir machen wegen des Ortswechsels keine Abstriche an unserem hohen Niveau und zeigen die wichtigsten Positionen zeitgenössischer Kunst.
Haben Sie es geschafft, der lokalen Bevölkerung einen anderen Zugang zu verschaffen?
Paul Aguraiuja: Wir haben schnell gemerkt, dass wir ein öffentliches Rahmenprogramm brauchen, und zwar auch in russischer Sprache. Das brachte uns wiederum Kritik vom estnischen Publikum ein, vor allem als der Ukraine-Krieg begann. Die russische Sprache ist aber nur ein Mittel, um die Menschen in Lasnamäe zu erreichen. Wir haben auch neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter russischer Muttersprache in unser Team aufgenommen. Sie verstehen den Hintergrund und das Kulturverständnis der Lasnamäer besser und können ihnen erklären, warum wir diese Art von Kunst zeigen. Einen grossen Einfluss hat die Arbeit, die wir mit den örtlichen Schulen leisten. Es kommen viele Schulklassen zu uns, denen wir Programme auf Estnisch und Russisch anbieten. Ganz neu haben wir noch eine Art Transferprogramm für Kinder, die russischsprachige Schulen besuchen, aber Estnisch lernen wollen.
Hat sich dank diesen Interventionen nach zwei Jahren etwas verändert?
Paul Aguraiuja: Ja, wir sehen eine Veränderung und Anzeichen dafür, dass der Pavillon funktioniert. Noch können wir nicht sagen, ob dies von Dauer sein wird. Beispielsweise besuchen jene älteren Damen, die uns zu Beginn beschimpften, wir hätten ihnen mit unserem Pavillon den Platz für die Weihnachtstanne weggenommen, nun regelmässig Ausstellungen. Das finde ich phantastisch! Ich weiss nicht, ob sie die Kunst immer lieben oder verstehen, aber zumindest schreien sie uns nicht mehr an und besuchen uns immer wieder. Ende des vergangenen Sommers erlebte ich ein wahres Wunder: Wir hatten im Innenhof einen Gemeinschaftsgarten mit Hochbeeten, für die sich jeder, der wollte, bewerben konnte. Nun haben sich besagte Damen wie auch zeitgenössische Künstler dafür beworben und mitgemacht. Eines Tages sah ich die Damen zusammen mit einer sehr kritischen und politisch meinungsstarken feministischen Künstlerin aus Tallinn beim Tee sitzen und reden. Und sie hatten sich etwas zu sagen. Das ist genau das, worum es uns geht. Deshalb sind wir hierhergekommen.
Wie kommt der Pavillon beim früheren Publikum an?
Paul Aguraiuja: Die Gesamtbesucherzahl pro Ausstellung ist verglichen mit der alten Kunsthalle gleichgeblieben. Doch 75 Prozent des Publikums ist neu. In der Innenstadt von Tallinn war die durchschnittliche Besucherin eine estnischsprachige Frau, 55 plus. Heute besuchen uns vor allem russischsprachige Familien, 35 plus. Wir haben also einen Grossteil unserer früheren Klientel verloren. Als Grund dafür wird etwa genannt, dass Lasnamäe eine unheimliche Gegend sei. Dabei ist es eine absolut sichere, normale Wohngegend. Als weiterer Grund wird die Distanz zum Zentrum kritisiert. Allerdings kann man den Pavillon von dort aus innert zehn Minuten mit dem Bus erreichen.
Was die Architektur angeht: Bewährt sich das Gebäude? Oder würden Sie es heute anders planen?
Paul Aguraiuja: Das Gebäude ist wirklich gut, der Raum funktioniert wie ein kreisförmiger Tunnel. Das setzt den Ausstellungsmachern einige Grenzen. Man muss alles speziell für diesen Raum entwerfen. Wenn man damit zurechtkommt, hat man fast unbegrenzte Möglichkeiten. Der Raum hat keine Fenster, und sowohl sehr hohe als auch sehr niedrige Decken. Dass bisher jede Ausstellung wieder ganz anders aussah, liegt auch an den Räumlichkeiten. Sie bieten viele Möglichkeiten. Wir hatten Ausstellungen mit Kisten, in denen Videos liefen. Wir hatten Gemälde von der Mitte des Daches hängen. Wir hatten Ausstellungen, in denen man durch einen narrativen Tunnel gehen und klettern musste.
Der Pavillon ist mit der Idee entwickelt worden, dass er abgebaut und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden könnte. Gibt es dafür schon Pläne?
Paul Aguraiuja: Wir haben den Pavillon theoretisch so geplant. Ob ein Ab- und Wiederaufbau tatsächlich möglich ist, haben wir nicht getestet. Doch gerade in den letzten zwei Wochen habe ich erste Gespräche mit einigen Politikern geführt. Sie scheinen zu verstehen, dass Lasnamäe einen überregional bedeutenden Kunstort braucht. Wir von der Kunsthalle sind bereit, den Pavillon weiterzubetreiben, als zweiten Programmierungsstandort neben der Kunsthalle im Zentrum. Die Verhandlungen über die Finanzierung beginnen im Januar 2025.
Der Pavillon ist zwar ein Elementbau. Uns von modulart würde aber auch brennend interessieren, wie verbreitet die Modulbauweise in Estland ist?
Paul Aguraiuja: Modular zu bauen, ist in Estland noch relativ neu, aber ein Bereich, der rasant wächst. Vor allem bei Häusern für den Sommer liegt der Modulbau im Trend. Es gibt auch schon viele Unternehmen, die Elemente oder Module vorfertigen.
Ja, wir sehen eine Veränderung und Anzeichen dafür, dass der Pavillon funktioniert. Noch können wir nicht sagen, ob dies von Dauer sein wird. Beispielsweise besuchen jene älteren Damen, die uns zu Beginn beschimpften, wir hätten ihnen mit unserem Pavillon den Platz für die Weihnachtstanne weggenommen, nun regelmässig Ausstellungen.

Foto: Tönu Tunnel
Prix Kunst und Ethik 2024 für die Kunsthalle Tallinn
George Steinmann, wieso verleihen Sie als Künstler anderen Kunstschaffenden einen Preis?
George Steinmann: Der Prix Kunst und Ethik ist eine wachsende Skulptur in Form eines Kunstpreises. Damit will ich Kunstschaffende unterstützen, die mit ihrer Haltung radikal neue Wege beschreiten. Ihre engagierte Kunst wird oft nicht verstanden, auch nicht von sogenannten Kunstfachleuten. Mit meinem Preis stelle ich zudem auch die üblichen Mechanismen der Kulturförderung infrage. Braucht Kunst die Politik? Oder ist es vielmehr die Politik, welche die Kunst braucht? Das Geld für den Preis kommt deshalb konsequenterweise nicht von den bekannten staatlichen Kunstförderern, sondern von privaten Personen und Firmen, darunter auch Bauart Architekten.
Wie kamen Sie darauf, die Kunsthalle Tallinn mit dem Preis zu ehren?
George Steinmann: Durch mein Werk «Ruumi naasmine» (The Revival of Space, 1992–1995) – die vollständige Renovierung der Tallinner Kunsthalle als nachhaltige, wachsende Skulptur – fühle ich mich der Institution eng verbunden. Mein Werk und die wunderbare Zusammenarbeit von damals haben grosse internationale Resonanz erzeugt. Im Frühling 2022 teilte mir Paul Aguraiuja dann mit, dass das Gebäude wieder renoviert werden müsse. Sie luden mich, in Wertschätzung meiner früheren Arbeit, zu ihrem Workshop ein, um über ein temporäres Projekt nachzudenken. Daraus entwickelte sich dann die Idee, den nächsten Prix Kunst und Ethik nicht einem Künstler, sondern der Kunsthalle Tallinn zu verleihen. Ich erachte die Haltung der Kunsthalle Tallinn als ausserordentlich wichtig und unterstütze mit dem Preis ihr grosses sozio-kulturelles und visionäres Engagement.
Sie haben Bauart Architekten erwähnt? Was verbindet Sie mit diesem Büro?
George Steinmann: Einerseits ganz konkret die vielschichtige Zusammenarbeit für diverse Kunst-am-Bau-Projekte, etwa das Projekt «Kunst ohne Werk aber mit Wirkung» für den Neubau der Ara Bern (2012). Andererseits auf der Metaebene das langjährige Engagement als Mitglied des Beirats, in den ich meine Haltung als Künstler einbringen konnte. Ein uns verbindendes Element ist die Vision der Nachhaltigkeit, sowohl im architektonischen Bereich wie auf der künstlerischen Ebene.
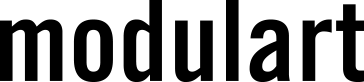







Schreiben Sie einen Kommentar
Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.